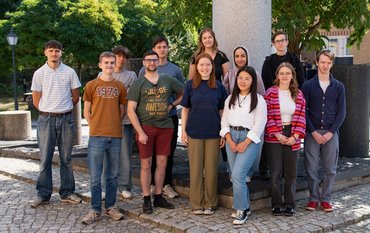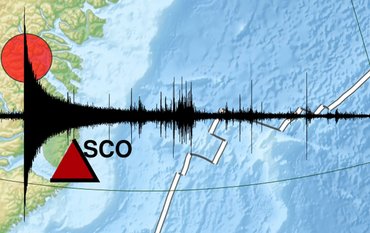Mit dem Begriff Geoengineering verhält es sich ein bisschen wie mit dem Quantensprung: Im wörtlichen Sinne ist etwas ganz anderes gemeint als im allgemeinen Sprachgebrauch. So wie ein Quantensprung eigentlich nur eine winzig kleine Änderung des Energieniveaus eines Elektrons ist und nicht etwas Weltbewegendes, so gehört Geoengineering im engeren Wortsinn zum Alltag der Menschheit seit vielen Jahrtausenden. Bergbau, Umleitung von Flüssen, Tunnelbauwerke, Stauseen oder Entwässerung: All das sind massive Eingriffe in den Untergrund, die man nach meinem Verständnis als Geoengineering bezeichnen müsste. Wer heute davon spricht, meint aber meist Climate Engineering – und so ist es nicht verwunderlich, dass das Thema zuverlässig dann in den Medien auftaucht, wenn große Klimakonferenzen wie jetzt in Katowice, Polen, anstehen oder wenn es um die Erreichung beziehungsweise das Verfehlen der selbstgesteckten „Klimaziele“ Deutschlands geht.
Grob lassen sich zwei Klassen von Climate Engineering unterscheiden: einmal das aktive Abscheiden von CO2 bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe oder anderen CO2-emittierenden Prozessen sowie zum anderen die Beeinflussung der Sonneneinstrahlung auf die Erde, beispielsweise durch Einbringen von Partikeln in die Atmosphäre. Für beide Prozesse gibt es natürliche Vorbilder: Pflanzen entziehen der Luft CO2 und wandeln es in Biomasse um, seien es kurzlebige Blätter oder langlebiges Holz. Und Vulkane stoßen Rauch und Asche aus, die bis in die Stratosphäre dringen und dort zu einer Abschattung der Erde führen.
Die Mehrheit der Geowissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sowie auch die Politik sind sich einig, dass uns für großskalige Versuche, Schatten zu erzeugen, das Wissen um die möglichen globalen und regionalen Konsequenzen fehlt. Zu groß ist die Gefahr von unbeabsichtigten Nebenwirkungen als dass man jetzt einfach Ruß oder andere Substanzen zusätzlich und in großen Mengen in die Atmosphäre einbringen könnte. Was in der Debatte darum oft wenig beachtet wird: Es sind nicht nur diese unerwünschten Effekte, die Grund zur Sorge geben, sondern auch völlig ungeklärte und vermutlich auch nicht klärbare Fragen der globalen Governance.
Wer sollte bestimmen, wie viel Partikel mit welcher errechneten Wirkung ausgebracht werden? Dürfte ein Staat ein Veto einlegen? Wer würde haften, wenn etwas schief geht? Wer garantiert die Nachhaltigkeit der jeweiligen Maßnahme? Wie sollen diese finanziert werden – vor allem dauerhaft? Die Ideen zu solchen radikalen Maßnahmen, die es immer wieder in die Schlagzeilen schaffen, sind alt und bekannt – und sie bleiben mit großen ungeklärten Risiken und einer fehlenden völkerrechtlichen Grundlage behaftet.
Ganz anders sieht es mit der Abscheidung von CO2 aus. Hier gibt es bereits Verfahren, die im großtechnischen Maßstab funktionieren, beispielsweise in der Zementherstellung oder der chemischen Industrie. Es gibt auch längst etablierte Verfahren, das Kohlenstoffdioxid in den Untergrund zu verbringen – etwa bei der Förderung von Öl oder Gas. Wir am GFZ haben darüber hinaus nachgewiesen, dass es im Untergrund geeignete Schichten gibt, die CO2 aufnehmen und speichern können. Unser Pilotprojekt des Carbon Capture and Storage (CCS) in Ketzin hat gezeigt, dass das Gas sicher im Untergrund verbleibt und sogar zurückgeholt werden kann.
Diese Art von Climate Engineering ist also machbar, und ich halte sie für sinnvoll. CCS kann einen Anteil dazu beitragen, den CO2-Ausstoß zu verringern, in vielen Szenarien des Weltklimarates IPCC spielt CCS auch eine Rolle. Für eine Verringerung des CO2-Gehalts in der gesamten Atmosphäre sind aber weitere Maßnahmen notwendig. Hier wären die erforderlichen Reduktionsmengen viel zu groß, und hier sind auch potenziell schädliche Nebenwirkungen zu beachten. Wer etwa an negative Emissionen denkt, indem Biomasse – Grünpflanzen auf Äckern oder schnellwachsende Gehölze – erzeugt wird, die dann Energie liefern könnte bei gleichzeitiger Abscheidung des CO2, der vernachlässigt die Folgen, die das für Böden bzw. Ökosysteme und die Nahrungsmittelproduktion haben würde. Stichworte sind Monokultur bzw. Biodiversitätsverluste wie Insektensterben sowie die Flächenkonkurrenz („food or fuel“).
Dagegen hat die Industrie bereits jetzt schon Prozesse etabliert, die CO2 abscheiden. Es fehlt eine Infrastruktur, das Gas dorthin zu transportieren, wo es im Untergrund gespeichert werden könnte, aber das ließe sich lösen. Auch der Preis spielt eine Rolle. Noch ist CCS zu teuer, doch es ist zu erwarten, dass durch so genannte Upscaling-Effekte sich zum einen der Preis verringert und dass zum anderen die Preise ansteigen, die für die Freisetzung von CO2 anfallen.
Es geht dabei gar nicht um den dauerhaften Verbleib im Untergrund. Vielmehr gibt es interessante Forschungsansätze, „grünen Wasserstoff“ chemisch zu verpacken und damit über lange Strecken transportierbar zu machen. Man könnte also in sonnenreichen Gegenden Wasserstoff erzeugen und ihn mit CO2 zu künstlichem Treibstoff auf Methanolbasis umwandeln. Dies ist für die bestehende Transportinfrastruktur (Schiffe, Lastwagen, Flugzeuge) von Bedeutung. Ja, man sollte an Batterieantrieben arbeiten – aber Batterien verbrauchen ebenfalls Ressourcen und bergen eigene Risiken.
Ja, es ist besser, CO2 gar nicht erst entstehen zu lassen – aber man muss sich die Ökonomie und die Infrastruktur realistisch anschauen. Und ja, auch wenn wir gezeigt haben, dass CCS beherrschbar ist, kann es bei unsachgemäßer Handhabung zu Leckagen kommen – nur wären diese dann von lokaler Bedeutung und nicht, wie bei anderen Climate Engineering-Ideen, von globalem Ausmaß. Aus diesen Gründen plädiere ich für die weitere Erforschung und auch die technologische Umsetzung von CCS und auch CCU (das U steht für Utilization, also für Nutzung). Ohne die Einbeziehung des geologischen Untergrunds ist das nicht zu machen. Und die Erwartungen an die Effekte müssen realistisch bleiben.
Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Hüttl ist Wissenschaftlicher Vorstand des GFZ und Vorsitzender des Vorstands